MONTAG, 12. JUNI 2017
FEUILLETON
Das Genie der Masse
Jeder kennt Steve Jobs als den Gründer von Apple, aber was macht ihn sonst noch als Computerweltenschöpfer aus? Von Dirk Burckhardt
Kein Pionier der Computerkultur hat die kollektive Phantasie stärker beschäftigt als Steve Jobs. Der Weg von Apple aus der Garage zum wertvollsten Unternehmen der Welt ist zum modernen Mythos geworden, endlos besungen, erzählt und verfilmt. Auch wenn die Biographie des Schöpfers langsam verblasst, Jobs Produkte (von Macintosh, iMac, iPod, iPad, iPhone, und iTunes bis zum App Store) sind zu Ikonen des Alltags geworden. Die Massen, die zu den Apple Stores pilgern, begreifen sich als Mitglieder einer Gemeinschaft, die man abschätzig eine Kirche des Nichts, ebenso gut aber auch Begründer eines Lebensstils nennen könnte. Oder stärker noch: eine soziale Plastik.
Und vielleicht kommt diese Betrachtungsweise der Vita, aber auch dem Selbstverständnis von Steve Jobs am nächsten. Denn er verstand sich weniger als Unternehmer, denn als Künstler. Worin aber bestand seine Kunst? Darin, dass er seine Produkte nicht als tote Dinge, sondern als animierte Wesen begriff, als einen Zauberspiegel, in dem der Nutzer, in veredelter Form, sich selbst wiedererkannte. So galt ihm das Schneeweiß eines Geräts nicht als Oberflächenphänomen, sondern als nach außen gestülpte Seele; ebenso begriff er das Auspacken eines Geräts nicht als bedeutungslosen Akt, sondern als Ereignis, das inszeniert und mittels Patenten geschützt werden musste.
Keine Kompromisse, nirgends! Weil er es nicht ertrug, minderwertige Dinge um sich zu haben, dachte Jobs wochenlang über den Kauf einer Waschmaschine nach, oder mutete es seinen Gästen in Ermangelung eines kaufwürdigen Sitzmöbels zu, auf dem Boden zu sitzen. Dass dieses Streben nach materieller Perfektion in einer Welt stattfand, die sich dematerialisiert und zu einer sozialen Plastik auflöst, mag paradox anmuten – in der Vorstellungswelt des Steve Jobs lautete jedoch die höchste Maxime: Nicht das Sein, das Design bestimmt das Bewusstsein.
Mag sein, dass bei alldem auch der Genius Loci seine Hände im Spiel hatte. Aufgewachsen im kalifornischen Mountain View, wo William Shockley die erste Halbleiterfirma gegründet und Robert Noyce zunächst Fairchild und dann Intel ins Leben gerufen hatte, keine halbe Stunde von Douglas Engelbarts Stanford Research Institute oder den Räumen von Xerox Parc entfernt, gehörte Steve Jobs der ersten Generation an, die den Geist des Silicon Valley atmete – ohne es zu wissen. Was ihn prägte, war das Eichler-Haus, in dem er aufwuchs: preisgünstig, modern, von jener Einfachheit, bei der die Form die Funktion hervortreten lässt (wie später der iMac durch seine farbige transparente Hülle seine Innereien preisgeben sollte). Jobs war ein intelligentes, aber aufsässiges Kind und entwickelte neben ausgeprägter Willensstärke ein Gefühl der Auserwähltheit. Was wohl mit der rätselhaften Herkunft des verstoßenen Adoptivkinds zu tun hatte.
Umgeben von Wunderdingen wie Solarzellen, Transistoren oder Radar, explodierte in Jobs’ Jugend das Lebensgefühl seiner Generation. So begann er als junger Mann mit LSD zu experimentieren und mit manchem mehr: Urschreitherapie, veganer Ernährung, Zen. So tief war das Bewusstsein des Renegaten in ihm verankert, dass er, als er sich in seiner eigenen Firma einmal an den Rand gedrängt sah, eine Piratenflagge über seiner Abteilung hisste. Selbst als Vorstandschef eines milliardenschweren Unternehmens empfand sich Jobs nicht als Teil des Establishments, sondern als Protagonist der Gegenkultur – als Rebell, der sich weniger mit Controllern und Unternehmensberatern als mit Künstlern und Designern umgab. Im Kontext des Silicon Valley war Kunst keine museale Veranstaltung, sondern praktische Utopie. Wie Marcel Duchamp, der in industriell gefertigten Dinge ready-mades sah, die mit einem Pinselstrich zum Kunstwerk geadelt werden konnten, begriff Jobs die Welt als einen Baukasten, der nach Belieben neu zusammengesetzt werden konnte. Im Grunde war es nicht anders als früher, als er mit seinem Adoptivvater (einem Mechaniker, der alte Autos frisierte) über die Schrottplätze gewandert war und nach kostbaren Einzelteile gesucht hatte.
Jobs tat sich weniger als Erfinder oder genialer Programmierer hervor, sondern als derjenige, der mit schnellem Blick die Gelegenheit, das große Ganze erfasste. Als der Siebzehnjährige im Homebrew Computer Club den gleichgesinnten Steve Wozniak kennenlernte, dem es gelungen war, sich aus handelsüblichen Teilen einen eigenen Computer zusammenzubauen, begann eine Freundschaft, die (wie alles in Jobs’ Biographie) die Züge einer Vereinnahmung hatte. Oder wie der umgängliche Wozniak sagte: „Jedes Mal, wenn ich etwas Großartiges entwickelt hatte, fand Steve eine Möglichkeit, es in klingende Münze umzusetzen.“ Ausgangspunkt ihrer Zusammenarbeit war die Entdeckung, dass man über eine bestimmte Klangfrequenz Telefongesellschaften austricksen und umsonst Ferngespräche führen konnte. Während Wozniak einen Schaltkreis vor Augen hatte, erfasste Jobs das Produkt: eine Blue Box, mit der man umsonst in die ganze Welt telefonieren konnte. Und weil sich dieses Wunderding in Studentenkreisen blendend verkaufte, erkannte Jobs das Potential für eine Firmengründung.
Nach einem Job bei der Computerfirma Atari hatte er zunächst den College-Fonds seiner Eltern in einer teuren Privatuniversität (wo er lediglich Kalligraphiekurse besuchte) vergeudet, danach eine Zeitlang in einer Kommune gelebt, wo er für das Beschneiden der Apfelbäume zuständig war, schließlich war er nach Indien gepilgert. Dort hatte Jobs zum Buddhismus und zu jener Einsicht gefunden, die sein Leben begleiten sollte: Gott liegt im Detail. Einfachheit bedeutet größte Sophistication. Apfelbäume gedeihen, wenn man sie beschneidet. Nach Amerika zurückgekehrt, entwickelte der College- Drop-out ungeahnte Aktivitäten. Binnen kurzem verwandelte er die väterliche Garage zu einer Fertigungsstätte, wo er, sein Vater und Wozniak die ersten fünfzig Exemplare des „Apple I“-Computers zusammenlöteten. Im Januar 1975 hatte die Zeitschrift „Popular Mechanics“ den ersten Computerbausatz vorgestellt; insofern war es nur eine Frage der Zeit, dass sich Wagemutige an die Aufgabe machen würden. Jobs hatte den Besitzer des Byte-Sops, eines kleinen Einzelhandels, überzeugen können, einige Exemplare eines solchen Selbstbaucomputers zu ordern.
In gewisser Hinsicht waren seine Garagenaktivitäten weniger revolutionär, als vielmehr Folge eines rätselhaften Blackouts. Denn die Firma Xerox verfügte, nachdem sie Millionen an Forschungsgeldern aufgewendet hatte, bereits 1973 über einen PC, wie ihn Apple erst ein Jahrzehnt später entwickeln sollte: mit Maus, graphischer Oberfläche, einem Textverabeitungssystem und Ethernet-Anschluss. Als man jedoch den Firmenoberen die Maschine vorstellen wollte, bekamen die Herren des Vorstandes bärtige, langhaarige Wissenschaftler zu Gesicht, die an Tastaturen arbeiteten. Da so etwas als Sekretärinnenarbeit galt, war sich die Firmenspitze einig: Das konnte kein ernstzunehmendes Produkt sein. Diese Geistesträgheit war die Chance der Bastler, die die nötigen Bauteile (die von den raumgroßen Ungetümen der fünfziger Jahre auf Fingernagelgröße zusammengeschrumpft waren) nun in Radioshack-Läden erwerben konnten.
Was Steve Jobs von den Konkurrenten unterschied, war, dass er von Beginn an auf ein formschönes, einfach zu bedienendes Gerät erpicht war. Jede Einzelheit, vom Gehäuse bis zum Netzteil, ja, bis zum ästhetischen Design der Platine, war sorgsam bedacht. Und weil er, anders als Wozniak, nicht selbst programmierte, ging es Jobs von Beginn an auch darum, was Nutzererfahrung bedeutet. Folglich war die Empathie, die innige Verbindung mit dem Gerät, die Maxime des neugegründeten Unternehmens: „Wir werden Ihre Bedürfnisse besser verstehen als jede andere Firma.“
Als die junge Firma ihre Prototypen 1977 auf einer Messe vorstellte (ein Ereignis, das Jobs perfekt inszenierte), war die Resonanz groß. Sehr bald waren Risikokapitalgeber zur Stelle, die die Gründer mit dem nötigen Startkapital ausstatteten. Trotz des großen Erfolgs begriff Jobs allerdings, dass der Apple-Computer noch weit hinter dem zurückblieb, was die Entwicklungsabteilung von Xerox Parc hergestellt hatte. Und nun gelang ihm sein eigentliches Meisterstück: Jobs sicherte sich für 10000 Apple-Anteile die Nutzungsrechte an den Xerox-Patenten, zudem konnte er die begabtesten Wissenschaftler (wie Alan Kay und Larry Tesler) für Apple gewinnen. Ein großer Künstler, hat Jobs vollmundig erklärt, kopiert nicht, er stiehlt. Natürlich stammte dieser Satz nicht von ihm, sondern war von Picasso geklaut.
Als Apple 1980 an die Börse ging, war Steve Jobs ein gemachter Mann. Dies war nicht allein sein Verdienst. Der rapide Preisverfall und die Fortschritte in der Prozessortechnik hatten dazu geführt, dass sich nun auch Zwerge auf die Schultern des Riesen stellen konnten. Nicht nur, dass Jobs seine Chance ergriff, er wurde auch zum Gesicht der Revolte, verlieh er dem Kauf eines PC doch das Gepräge einer bewusstseinserweiternden Maßnahme. Zur Markteinführung des Macintosh hat der Regisseur Ridley Scott einen Spot beigesteuert, in dem eine junge Sportlerin einer gleichgeschalteten, von einer Orwellschen Big-Brother-Gestalt kontrollierten Masse einen Hammer entgegenschleuderte. Beim Durchschlagen der Projektionsfläche wurde der Bildschirm weiß – als hätte ein Geistesblitz jegliche Erinnerung an die dunkle, totalitäre Vorzeit ausgelöscht.
Mit diesem Spot, der während des Super Bowl 1984 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, wurde der Computer zum Massenprodukt, zu einem leicht zu bedienenden anschmiegsamen Fetischgerät, das im Kopf hängenblieb, unter die Haut ging und sich im Geflecht der Nervenzellen verfing. Wurde Steve Jobs darüber zum Schutzheiligen aller User, gebärdete er sich firmenintern wie ein Tyrann. Dabei fielen seine Wutausbrüche, sein Körpergeruch oder die Marotte, seine Füße zum Stressabbau in die Toilette zu stecken, noch ins Register des Allzumenschlichen; gravierender war, dass er geradezu zwanghaft damit beschäftigt war, seine Freunde zu verraten, Mitarbeiter herabzuwürdigen und fremdes Gedankengut zur eigenen Leistung zu erklären. In der Firma war es eine stehende Redeweise, dass man sich in der Welt des Steve Jobs in einem Reality Distortion Field bewegte, auf dem Dichtung und Wahrheit nach Belieben verkrümmt werden konnten.
Sein bizarres Auftreten führte schließlich dazu, dass sich der Vorstand gegen den eigenen Gründer wandte und ihn von seinen Aufgaben entband. Doch dann nahm die Geschichte des genialen Vermarkters eine Wendung, die nichts mit kapitalistischer Vernunft, alles hingegen mit seiner Vision von beseelten Dingen zu tun hat. Denn dass die Animationsfirma Pixar, die von abtrünnigen Disney-Mitarbeitern gegründet worden war und in die Steve Jobs nun einen Teil seines Vermögens investierte, zum Triumph werden sollte, war keineswegs absehbar; allein der unerschütterliche Glaube von Jobs machte Filme wie „Toy Story“, „Ratatouille“ oder „Wall-E“ möglich.
Bald flehte der von Controllern heruntergewirtschaftete Apple-Konzern seinen Gründer an, zurückkommen. Jobs’ Rückkehr war ein nicht enden wollender Triumphzug. Denn was immer er in die Hand nahm, wurde ein Erfolg, der gelegentlich (wie im Falle des iPhone) weltverändernde Züge besaß. In seinen Händen verwandelten sich Produkte zu Fetischobjekten, wie auch die Apple Stores (die Jobs als schneeweiße Schneewittchensärge konzipiert hatte) zu Kultstätten wurden, zu denen Konsumenten pilgerten wie einst Gläubige an heilige Stätten. Wenn der Kapitalismus eine Religion ist, war Steve Jobs ihr Prophet: derjenige, der noch das Verschwinden der Dinge zum Kultereignis machte. Nicht das Produkt sollte im Apple Store im Vordergrund stehen, sondern das, was mit ihm angestellt werden konnte.
Hier liegt der Schlüssel zu seinem Erfolg: Ein Produkt ist ein Fetisch, der so lange auf seine Projektionsfähigkeit untersucht worden ist, bis er zum Spiegel seines Benutzers wird. Wenn also die Apple Stores pro Quadratmeter mehr Umsatz erzielen als irgendeine andere Warenhauskette, ist das ein Beleg dafür, dass die Aufmerksamkeitsökonomie nicht mehr um Dinge, sondern um narzisstische Größenphantasien kreist. Indes funktioniert die Logik der Verführung nur dort, wo man ihr gläubig erliegt, der Zauberspiegel also ein unverstandenes, dunkles Objekt der Begierde bleibt. Nicht zufällig war Jobs von Beginn an darauf bedacht, dass seine Geräte keine handelsüblichen Schrauben benutzten, so dass Unbefugte sie nicht auseinandernehmen konnten. Dieser Abschließungslogik folgend, wurde Apple selbst zu dem, was Jobs stets bekämpft hatte: eine Blackbox, ein sinistrer, undurchdringlicher Machtpol. Wie aber kann ein geschlossenes System in einer Welt offener Systeme bestehen? Ganz offenbar so lange, wie der Zauber des Künstlers noch anhält.
Die vorherige Folge unserer Serie über Computerweltschöpfer erschien am 16. März.
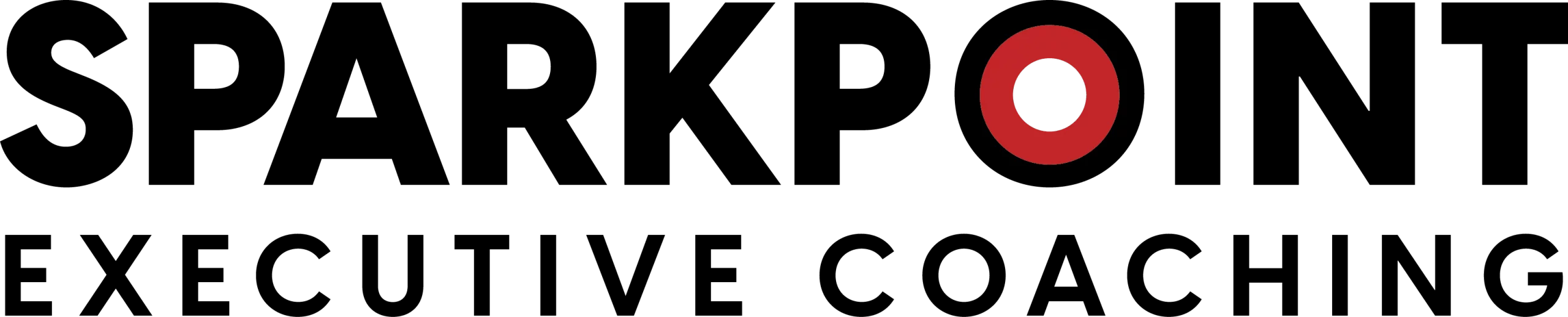
Recent Comments